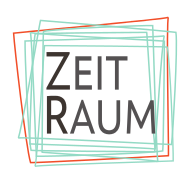SI- sensorische Integration
Warum ist sie so wichtig für die Entwicklung meines Kindes?

Was ist sensorische Integration?
Sensorische Integration ist das Ordnen und Verarbeiten von aufgenommenen Sinneseindrücken und Empfindungen.
Durch diesen Prozess der Reizweiterleitung – und verarbeitung, werden nicht nur Körperbewegungen und -haltungen gesteuert, sondern auch unser Handeln, unsere Sprache, das Lernvermögen und unsere Interaktionsfähigkeit beeinflusst.
Bei einer gut funktionierenden Integration kann ein Kind die aufgenommenen Sinneseindrücke vergleichen, koordinieren, Neues lernen und adäquate Verhaltensweisen entwickeln. Die aufgenommenen Sinneseindrücke werden in einem Informationsfluss zwischen den Nervenzellen des Körpers verarbeitet und integriert. Dieser Prozess ist eine wichtige Grundlage für unsere Handlungsfähigkeit im Alltag.
Was ist aber, wenn es nicht so einfach passiert, wie wir uns das wünschen?
Die 3 Basissinne aus der sensorischen Integration:
- Berührungssinn (taktiler Sinn) - Wo spüre ich eine Berührung? Fühlt sich etwas rau, glatt, fest, fein, pelzig...an?
- Gleichgewichtssinn (vestibulärer Sinn) - In welcher Position befinde ich mich? Bin ich in Bewegung oder in Ruhe? Verliere ich die Balance?
- Muskel- oder Kraftsinn / Tiefensensibilität (propriozeptiver Sinn) - In welcher Stellung befindet sich mein Körper? Wie viel Kraft brauche ich, um etwas zu tun? In welche Richtung bewege ich mich?
Die oben aufgeführten Sinne sind die sogenannten Nahsinne. Hinzu kommen die Fernsinne. Diese sind der Geruchs-(olfaktorisch) und Geschmackssinn (gustatorisch), der Sehsinn (visuell) und der Hörsinn (auditiv).
Was bedeutet eine sensorische Integrationsstörung?
Von einer Sensorischen Integrationsstörung spricht man, wenn Sinneseindrücke im Gehirn nicht ausreichend gut verarbeitet werden. Es kommt zur unzureichenden oder falsch gesteuerten Übermittlung und Speicherung von Informationen aus dem eigenen Körper. Daraus folgt, dass die Reaktionen des Kindes für die Außenwelt oft unverständlich werden. Es kann z.B. sein, dass das Kind Schwierigkeiten hat, sein Verhalten an das, was angemessen scheint, anzupassen.
Die Ausprägungen und damit das Reagieren des Kindes auf bestimmte Reize sind sehr verschieden und oft erst auf den zweiten Blick verständlich. Die Auswirkungen zeigen sich unter anderem in der Bewegung, dem Leistungsniveau und im Sozialverhalten.
Wie äußert sich eine sensorische Integrationsstörung bei meinem Kind?
- Warum stolpert die 4-jährige Ida so häufig?
- Wieso kann Mohammed mit sieben Jahren und unzähligem Üben noch kein Fahrrad fahren?
- Warum möchte Jens nie auf den Spielplatz und mit den anderen schaukeln?
Sensorische Integration läuft unbewusst und automatisch ab. Die unbewusste Verarbeitung so großer Informationsmengen ist notwendig, damit wir unsere bewusste Anstrengung und Aufmerksamkeit höheren Leistungen, wie beispielsweise dem Lesen, widmen können.
Stellen Sie sich vor, sie müssten jeden Tag aufs Neue Autofahren erlernen. Wenn ihre Handlungen nicht automatisiert wären , würden sie sich viel mehr anstrengen müssen und könnten sich in einer fremden Stadt nur schwer auf neue Wege konzentrieren.
Ein Kind mit Störungen der Sensorischen Integration muss sich zum Beispiel darauf konzentrieren, nicht vom Stuhl zu fallen. Es kann daher dem Buchstaben, den es schreiben soll, weniger Aufmerksamkeit widmen, da zusätzlich zum Schreiben auch das Sitzen für dieses Kind eine Anstrengung bedeutet. Oftmals leiden deshalb, trotz guter kognitiver Voraussetzungen, die schulischen Leistungen.
Weitere Beispiele wie sich eine Sensorische Integrationsstörung äußert
- Abneigung gegen Lebensmittel und Textilien aus dem alltäglichen Leben
- Übersensibilität bei Hautkontakt
- Koordinationsschwierigkeiten, Ungeschicklichkeit und Probleme mit der Feinmotorik
- Schwierigkeiten in der Grobmotorik
- Eine Störung der Bewegungsplanung
- Unaufmerksamkeit und mangelnde Organisation
- langsames Erlernen von stehen, laufen und anderen neuen Bewegungsabläufen
Wie helfen wir Ihrem Kind und Ihnen?
Wir Ergotherapeuten sind spezialisiert auf die Behandlung sensorischer Integrationsstörungen. Das Wissen um Wahrnehmungsprozesse (Zusammenspiel der Sinne) und die Förderung der Reizverarbeitung, ist die Grundlage der SI-Therapie.
Aus den Gesprächen mit Eltern und Kind, sowie den Beobachtungen und Testergebnissen, ergibt sich ein Befund, der die Stärken und Schwierigkeiten in der Reizverarbeitung zeigt.
Gemeinsam mit Ihnen formulieren wir daraufhin ein konkretes Behandlungsziel zur Verbesserung der Funktionen in Bezug auf konkrete Alltagsschwierigkeiten.
In einer bewusst gestalteten Umgebung helfen wir Ihrem Kind, seinen Fähigkeiten entsprechende, anpassende Reaktionen auszuführen. Die Art der Reizsetzung und die Dosierung werden beobachtet und der Reaktion des Kindes angepasst.
Inhalte sind spielerische Angebote in sinnvollen Handlungen zu den unterschiedlichen Sinnesbereichen:
- taktil (Berührung)
- propriozeptiv (Tiefensensibilität)
- und vestibulär (Gleichgewicht)
- im Zusammenspiel mit den Fernsinnen.
Das Kind wird an Handlungen herangeführt, die es unterstützen und ihm ermöglichen, sich erfolgreich mit sich und seiner Umgebung auseinanderzusetzen und seine Alltagskompetenzen zu stärken.
Was macht mein Kind in der SI- Behandlung?
Die 5-jährige Paula kam mit Ihrer Mutter zur Therapie. Paula wollte unbedingt selbstständig schaukeln können. In der Anamnese stellte sich raus, dass sie es vermied, mit anderen auf den Spielplatz zu gehen, weil sie nicht wusste, wie sie schaukeln sollte. Außerdem wurde ihr dabei schnell übel, wenn sie angeschubst wurde. Dies hatte zur Folge, dass sie diese Handlung vermied und gar nicht mehr auf den Spielplatz gehen wollte. Die Mutter war unsicher, wie sie ihrem Kind helfen könnte und hatte Sorge, dass sich Paula immer weiter isoliere. Auch zuhause widmete sich Paula überwiegend Spielen am Boden und bewegte sich allgemein eher wenig.
Nach der Befundphase wurde deutlich, dass Paula Unsicherheiten im Gleichgesichtssinn zeigte und in diesem Bereich schnell überreizt war. Insgesamt zeigten sich Hinweise auf eine Störung der posturalen Kontrolle und bilateralen Integration mit vestibulärer Verarbeitungsstörung.
Im ersten Schritt klärte die Therapeutin die Eltern über das Störungsbild auf und bestärkte sie darin,das Handeln ihres Kindes im Alltag besser zu verstehen.
In der Therapie setzte die Therapeutin gezielt Gleichgewichtsreize in Kombination mit tiefensensiblen Reizen ein, sodass Paula trainieren konnte, ihren Körper besser einzuschätzen. Dazu nutze sie die unterschiedlichen Angebote im Motorikraum. Paula hatte zunehmend Spaß an der Bewegung und zeigte angepasste Reaktionen, die sich positiv auf ihre Handlungen auswirkten. Ihre anfängliche Abneigung und Misstrauen lösten sich schnell auf.
Nach ca. 10 Therapieeinheiten wusste sie, wie sie ihren Körper einsetzten konnte, um Schwung zu nehmen und konnte einschätzen, wie viele Reize sie verträgt. Das motivierte sie, immer mehr auszuprobieren und dadurch ihr Handlungsrepertoire zu vergrößern.
So unterstützen Sie ihr Kind spielerisch zu Hause (je nach Altersstufe)
Lassen Sie ihr Kind krabbeln: über Kissen, unter Stühlen, durch Tunnel, vorwärts, rückwärts, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Lassen sie es um die eigene Körperachse rollen: es kann sich in eine Decke oder Matte einrollen, ein Geschwisterkind kann sich obendrauf legen, sodass das untere Kind ganz viele Spürinformationen erhält.
Gehen Sie mit Ihrem Kind auf den Spielplatz und lassen es klettern, schaukeln, wippen, etc.
Sensorische Integrationsstörung bei Erwachsenen?
Die Sensorische Integration begleitet uns ein Leben lang. Denn auch im Alter lernen wir unsere Umwelt genauer wahrzunehmen und unsere Sinne zu schärfen. Eine Störung tritt meist bei der Entwicklung des neurologischen Systems im Kindesalter oder in Kombination mit einer Demenz auf. Bei Demenzerkrankungen entsteht durch das beeinträchtigte Nervensystem eine sensorische Integrationsstörung. Diese äußert sich häufig durch Unzufriedenheit in alltäglichen Situationen. Berührungen und Bewegungen werden als unangenehm empfunden und der Körper des Betroffenen verkrampft und reagiert teilweise mit Abwehr. Die Leidtragenden lassen sich dann nur schwer beruhigen. Berührungen oder Versuche gut zuzureden, scheitern in diesen Momenten.
Andere Beispiele für sensorische Integrationsstörungen treten durch Fehleinschätzung der Intensität von Reizen auf und führen zu Überforderung, Stress und teilweise sogar Aggressionen. Die Folgen können unter anderem Hyperaktivität, Koordinationsstörungen, Unaufmerksamkeit und Desorganisation, sowie ADHS oder Schizophrenie sein.
Was können Sie und Angehörige tun?
Es ist wichtig dem Gehirn zu ermöglichen die Verarbeitung von Sinneseindrücken wieder neu zu erlernen.
Dies können Sie mit folgenden Ideen im Alltag ganz leicht umsetzen:
- Massagen mit verschiedenen Ölen, Cremen und Bürsten
- Erfühlen von Temperaturen und Alltagsgegenständen
- Fahrrad fahren, oder andere Tätigkeiten, die das Gleichgewicht fördern
- Geschicklichkeitsspiele wie Mikado z.B.